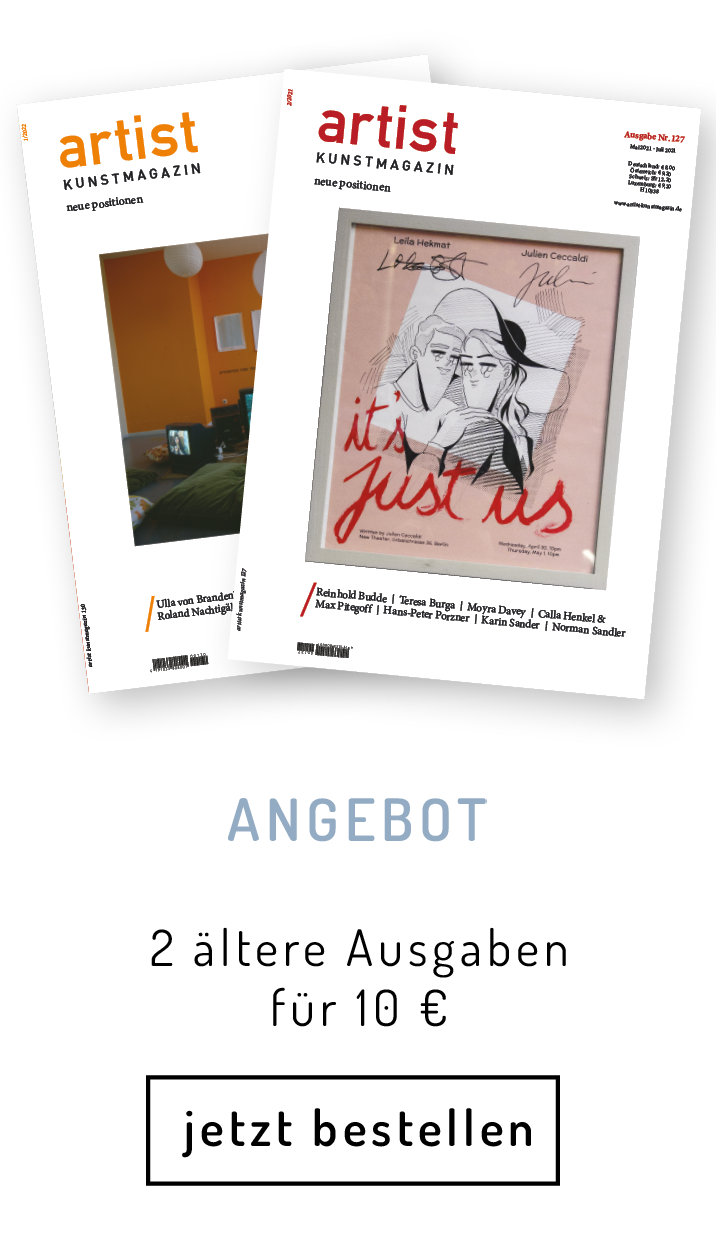Pan Daijing, Daniel Lie, Hanne Lippard und James Richards erhalten den Preis der Nationalgalerie, der im Jahr 2024 erstmals an vier Künstler:innen verliehen wird. Das neue Format des Preises nimmt den Gedanken der Ausstellung als kollektiven Austausch auf und strebt die Erweiterung der Sammlung durch den Ankauf der vier Neuproduktionen an. Die Preisträger:innen produzieren vier neue Arbeiten, die von April bis September 2024 in einer gemeinsamen Ausstellung im Hamburger Bahnhof gezeigt werden. Die Jury für den Preis der Nationalgalerie 2024 setzt sich zusammen aus vier internationalen Direktor:innen sammelnder Institutionen: Cecilia Alemani (Direktorin und Chefkuratorin High Line Art, New York), Elvira Dyangani Ose (Direktorin MACBA, Barcelona), Kasia Redzisz (Künstlerische Direktorin KANAL — Centre Pompidou, Brüssel) und Jochen Volz (Generaldirektor Pinacoteca do Estado, São Paulo) sowie Sam Bardaouil und Till Fellrath (Direktoren Hamburger Bahnhof, Berlin) und Gabriele Knapstein (stellv. Direktorin und Sammlungsleiterin Hamburger Bahnhof, Berlin).
Sie folgt auf Katja Schroeder und tritt die Stelle im Juli 2023 an. Anna Nowak studierte Kunstgeschichte, Ostasiatische Kunstgeschichte und Ethnologie an den Universitäten in Heidelberg, Paris und Berlin sowie Kulturmanagement in Berlin. Auf der dOCUMENTA (13) realisierte sie über zwanzig künstlerische Projekte und arbeitete u. a. mit Amar Kanwar, Shinro Ohtake, Haris Epaminonda und Daniel Gustav Cramer (2011-2012). Im Anschluss betreute sie in der Galerie Sfeir-Semler, Hamburg / Beirut internationale Ausstellungsteilnahmen viel beachteter Künstler*innen wie Anna Boghiguian, Wael Shawky oder Walid Raad (2013-2016). Im Kunstverein in Hamburg initiierte sie die ersten monografischen Ausstellungen von Georgia Gardner Gray, Basel Abbas und Ruanne Abou-Rahme (2017-2018) in Deutschland. Seit 2019 ist sie Kuratorin im Kunsthaus Hamburg mit den Schwerpunkten Transkulturalität, Digitalität und Biodiversität. Hier konzipierte sie Gruppenausstellungen, wie hybrID (2019) zur Ambivalenz und Vielschichtigkeit räumlicher und kultureller Verortung oder Making Kin (2020), bei der die Künstlerinnen Melanie Bonajo, Madison Bycroft und Anne Duk Hee Jordan Gemeinschaftskonzepte innerhalb der Artenvielfalt erforschten. Besondere Beachtung fanden die ersten Einzelausstellungen von Carlos León Zambrano (2021) und Leyla Yenirce (2022).
Ahrens begann 1986 unter der Leitung von Direktor Carl Haenlein zunächst als wissenschaftlicher Assistent in der Kestner Gesellschaft in Hannover, dann als Kurator und war von 1994 bis zu seinem Weggang 2003 stellvertretender Direktor des Hauses. Ahrens hat Literatur- und Theaterwissenschaften sowie Kunstgeschichte studiert. »Er war ein rastloser und kompromissloser Kurator, der von Künstlern für sein Engagement verehrt wurde«, hieß es in einer Mitteilung der Kestner Gesellschaft. Während seiner Zeit in der Kestner Gesellschaft hat Carsten Ahrens zahlreiche Ausstellungen kuratiert, darunter Einzelausstellungen der Werke von John Baldessari, Jean-Michel Basquiat, Louise Bourgeois, Pedro Cabrita Reis, Rebecca Horn, Thomas Huber, Mike Kelley, Jon Kessler, Astrid Klein, Olav Christopher Jenssen, Via Lewandowsky, Jonathan Meese, Kiki Smith, Robert Wilson und viele andere. Zu den Ausstellungen hat er Lesungen mit bekannten deutschen Schauspieler:innen wie Eva Mattes oder Edith Clever organisiert sowie Konzertreihen neuer Musik ins Programm geholt. Eine umfassende Retrospektive des Werkes von Jaume Plensa richtete er für das Museo Nacional Centro di Arte Contemporanea Reina Sofía in Madrid im Jahr 2000 ein. Für die Stiftung Schloss Neuhardenberg in Neuhardenberg bei Berlin war Ahrens mehrfach als Kurator tätig und zeigte dort Ausstellungen des Werkes von Einar Schleef mit einer Hommage an Schleef von Hans-Jürgen Syberberg (2002) und kuratierte zusammen mit seinem Bruder Gerhard Ahrens die Ausstellung »Joseph Beuys/Heiner Müller – Partisanen der Utopie« mit einer Hommage von Jonathan Meese (2004). 2004 wurde Ahrens Direktor des Mönchehaus Museum für moderne Kunst in Goslar und von 2005 bis 2013 war er Direktor des Neuen Museum Weserburg in Bremen. Mit Einzelausstellungen zu Jörg Immendorff (2007) und Helmut Newton (2008) konnte er Erfolge verbuchen sowie die Weserburg mit Präsentationen zum Schaffen von Stankowski (2007) oder der Themenausstellung »Freibeuter der Utopie«(2011) einem größeren Publikum öffnen. Bemerkenswert auch die Ausstellungen mit Frank Gerritz (2008) und das gemeinsam mit Olaf Metzel kuratiere Projekt »Circus Wols« (2012). Unter seiner Leitung begann auch die Kooperation mit dem kek Kindermuseum, das mit seinen thematisch wechselnden Mitmachausstellungen junge Menschen ins Haus brachte. Carsten Ahrens hat darüber hinaus die Ausstellung der Meisterschüler:innen der Hochschule für Künste Bremen an die Weserburg geholt, eine Reihe, die zusammen mit dem Karin Hollweg Preis einen wichtigen Beitrag zur Künstler*innenförderung bildet. Unter die Direktion von Carsten Ahrens fiel auch die wohl schwierigste Phase in der Geschichte des Museums. Zur langfristigen finanziellen Absicherung hatte sich die Stiftung Neues Museum Weserburg entschieden, Werke der eigenen Sammlung zu veräußern und damit einen »Zukunftsfonds« einzurichten. Zudem eröffnete Carsten Ahrens eine Debatte über einen veränderten Standort des Museums, die lange Jahre anhielt.