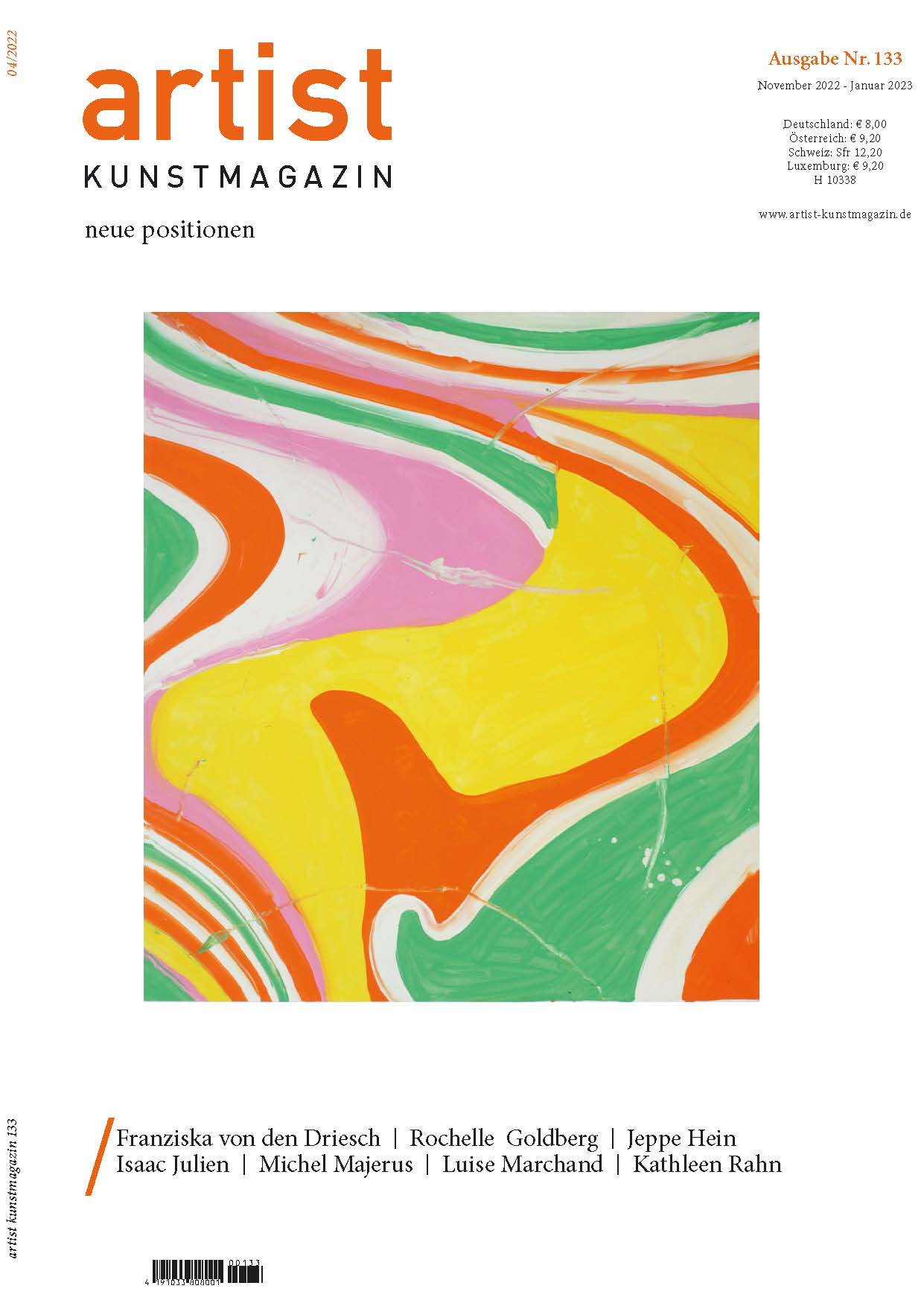Artist Ausgabe Nr. 133
Portraits
Michel Majerus | Jepp Hein | Isaac Julien | Rochelle GoldbergPage
Luise MarchandEssay
Roland SchappertPortrait

Pas de Deux No. 2 (Looking for Langston Vintage Series), 1989/2016, Ilford classic Silbergelatine-Kunstdruckpapier, auf Aluminium aufgezogen und gerahmt, 58.1 x 74.5 cm,
© Isaac Julien, Courtesy the artist and Victoria Miro, Courtesy Sammlung Wemhöner
© Isaac Julien, Courtesy the artist and Victoria Miro, Courtesy Sammlung Wemhöner
Textauszug
Isaac JulienIsaac Julien beschreibt seine Kindheit in »Riot«, einem lesenswerten Katalog, den das New Yorker Museum of Modern Art in 2013 herausgab, als es die Werke des Filmkünstlers in einer großen Ausstellung zeigte. Julien ist zu der Zeit 53 Jahre alt, und die Ausstellung markiert eine Apotheose in seinem künstlerischen Schaffen. Ihr sind indes schon etliche andere Bestätigungen und Ehrungen vorausgegangen wie Filmpreise für ihn in Berlin und Cannes oder seine Einladung zur Documenta in 2002. Und weitere werden ihr bis heute folgen wie Juliens Einladung zur Biennale in Venedig in 2015 oder seine Erhebung zu Ritter durch die Queen in diesem Jahr. Was dem Künstler erlaubt, seinem Namen ein elitäres »Sir« voranzustellen, Sir Isaac. Ein Privileg, das er selbst nicht nutzt, das aber von anderen sehr gerne verwandt wird, um ihn hochachtungsvoll anzusprechen und vorzustellen. Bei seiner vorerst letzten Auszeichnung in Goslar, wo man ihn im Oktober 2022 mit dem renommierten Kaiserring ehrte, wurde das überdeutlich sichtbar. Als Beobachter hatte man dabei manchmal das Gefühl, als würden die Goslarer bei sich am Liebsten die Monarchie wiedereinführen. Da ihr Preis seit 1975 verliehen wird, wurde mit ihm Juliens künstlerisches Schaffen auf eine Ebene mit dem von Künstlerinnen und Künstlern gestellt, die er seit Langem schätzt und verehrt, was ihm den Preis besonders lieb und teuer macht, obwohl er gänzlich ohne Dotierung ist.
Seine Lehrzeit schließt Isaac Julien 1989 ab, als er im Alter von 29 Jahren mit »Looking for Langston« sein erstes Meisterwerk präsentiert. Gedreht in 16 mm und in Schwarzweiß, gewinnt der Film noch im selben Jahr auf der Berlinale einen Bären. Um jedes Missverständnis von vorherein auszuschließen, es könne sich bei dem Werk um einen Dokumentarfilm handeln, nennt Julien seinen Film eine Meditation. Er denkt in ihm über das Leben des amerikanischen Dichters Langston Hughes nach, auch er ein homosexueller Schwarzer, der seine Sexualität sein Leben lang ängstlich zu verheimlichen suchte und dessen Gedicht »I, Too, Sing America« zur Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wurde. Meditationen sind in gewisser Weise alle Werke, die Julien danach noch realisieren wird. Er fertigt sie, wie er »Langston« gefertigt hat: In zugleich poetischer und politischer Weise und indem er dabei wie der Engel der Geschichte, über den Walter Benjamin geschrieben hat, zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft schaut. Seine Darstellung des Dichters geht von dessen Tod im Jahr 1967 aus, konzentriert sich dann aber auf Hughes’ Leben in den 1920er Jahren, in denen auch die soziale und kulturelle Bewegung der so genannten Harlem Renaissance ihre Blütezeit hatte. Eine Gruppe schwarzer Künstler, die mit ihren Werken zeitweise ein weißes Publikum zu begeistern wussten und zu der Hughes damals gehörte.
Was Julien in diesem Film in ingeniöser Weise demonstriert und was zum Charakteristikum aller seiner Werke werden wird, ist die raffinierte Zusammenführung von Fakten und Fiktion, von Inszenierung und found footage. Gleich die lange Eröffnungssequenz des Films macht das deutlich. Zu Beginn hält ein Engel, von Julien inszeniert, eine große Aufnahme von Hughes in die Kamera, fotografiert von Henri Cartier-Bresson. Filmtitel, Vorspann, Sirenenalarm folgen zusammen mit Archivaufnahmen. Eine Hochbahn fährt durch Manhattan, fast zeitgleich hört man eine Stimme aus dem Off. Es ist die der schwarzen Schriftstellerin Toni Morrison, die die Grabrede für James Baldwin hält, ein ebenfalls schwarzer und homosexueller Autor und brillanter Intellektueller, dessen Tod 1987 den Anstoß zu Juliens Film gab und dem er auch gewidmet ist. Dann Bilder der Trauerzeremonie, während Morrison die globale Gültigkeit des Werks von Baldwin preist, was sich auch auf Hughes beziehen lässt. So verbinden sich im Folgenden diese Archivbilder ganz natürlich mit der barocken Inszenierung der Beerdigung von Hughes durch Julien, in der der Dichter von ihm selbst dargestellt wird. Tot im offenen Sarg liegend, während Juliens Freunde und Familie die Trauergäste mimen. Dadurch wird in subtiler Weise eine thematische Kontinuität über drei Generationen nicht nur hergestellt, sondern postuliert, deren Protagonisten es um ihre sexuelle und rassische Identität und um soziale Befreiung und Emanzipation ging.
Isaac Julien arbeitet zum ersten Mal mit zwei Projektionsflächen in »Trussed« (1996), eine Studie über S&M-Rituale, und in »Vagabondia« (2000), dessen Thema die Geschichte des Sir John Soane’s Museum in London ist. Schon das zweifache Bilddispositiv erlaubt dialektische Gegenüberstellungen von hohem Reiz. Immer in höchst anregender temporaler Gleichzeitigkeit und nicht wie bei nur einer Projektion im zeitlichen Nacheinander. Für seinen Beitrag für die documenta 11, zu der ihn 2002 Okwui Enwezor einlädt, der sein enger Freund werden wird, sind es dann schon drei Projektionen. Mit seiner Installation »Paradise Omeros« überführt er dabei das traditionelle Triptychon aus der Malerei in die Filmkunst. Die Dreifachprojektion nutzt er auch 2006 bei einer Ausstellung in der hannoverschen Kestner Gesellschaft.
Geschichte und Gegenwart verknüpft Isaac Julien auch in seinem vorerst letzten Werk »Lesson of the Hour« aus 2019, einer Videoinstallation, die sogar aus zehn Projektionen besteht. Nur ist das Werk in Goslar, wo es aus Anlass der Kaiserring-Verleihung zusammen mit »Looking for Langston« in einer Ausstellung im Mönchehaus Museum gezeigt wird, der Raumsituation des Hauses geschuldet, lediglich in einer Ein-Kanal-Projektion zu sehen. Dennoch ist der Eindruck überwältigend.
Der Film handelt von Frederick Douglass (1818-1895), einem entflohenen Sklaven, der zum bedeutendsten Freiheitskämpfer seiner Zeit wurde. Als Autodidakt lernte er lesen und schreiben und wurde ein brillanter, sprachgewaltiger Redner und Autor, der in immer neuen Auftritten, unterstützt von seiner Frau Anna, für die Abschaffung der Sklaverei kämpfte, was ihn zum einflussreichsten und meist fotografierten Afroamerikaner seines Jahrhunderts machte. Julien hat in einer Mischung aus Fakt und Fiktion die Reise des jungen Douglass in den Jahren 1845 bis 1847 nach England, Irland und Schottland inszeniert, wo er Gleichheit und Freiheit für sich und seinesgleichen forderte. Der Künstler nutzte für diese Auftritte Exzerpte aus drei berühmt gewordenen reden, die Douglass indes erst später hielt, als er wieder in die Staaten zurückgekehrt war. Der Höhepunkt des Films, in dem der schwarze Schauspieler Ray Fearon von der Royal Shakespeare Company in der Rolle des jungen Douglass glänzt, ist dessen grandiose Rede zum 4. Juli. Der Tag, an dem sich die Staaten 1776 als unabhängig von Großbritannien erklärten, wird in den USA jedes Jahr groß gefeiert. Nur für die Schwarzen gab es damals nichts zu feiern. Sie wurden weiterhin als Sklaven behandelt. Und auch heute stimmen sie die prächtigen Feuerwerke und fröhlichen Paraden zum 4. Juli nicht wirklich froh. Wenn Isaac Julien diese Feiern auf der Leinwand entfaltet, überlagert er sie von Protestaktionen der »Black Lives Matter«-Bewegung, von Blaulicht, Polizeisirenen und Überwachungsdrohnen am Himmel.
Sie wollen mehr? Dann bestellen Sie doch direkt diese Ausgabe
> bestellen